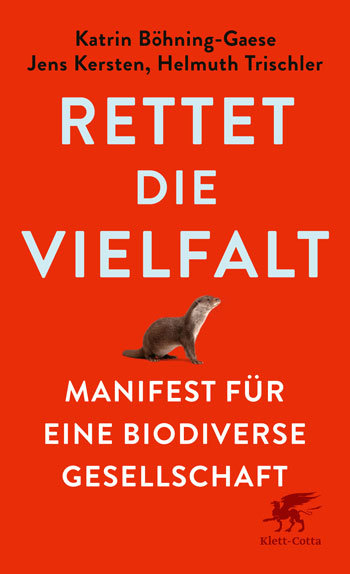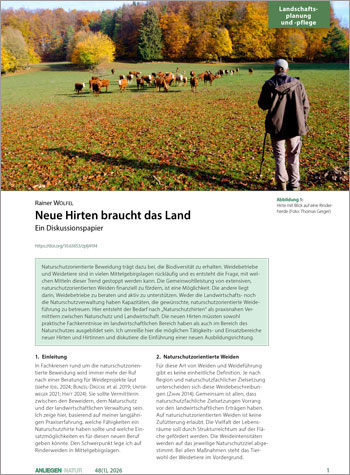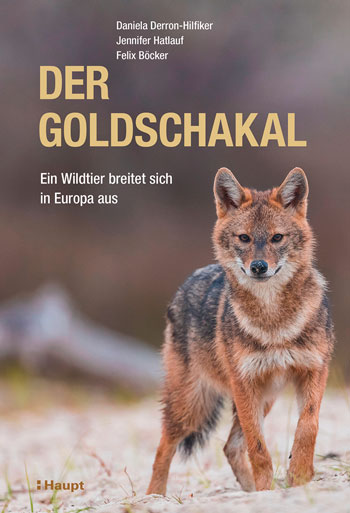Die bräunlich bis schwarz-grünliche Bachmuschel wird im Durchschnitt sechs bis sieben Zentimeter groß und war noch bis vor etwa 75 Jahren die häufigste heimische Bach- und Flussmuschelart Deutschlands (Foto: Andreas Hartl).
(Nadine Gebhardt) Moore bieten im nassen Zustand vielfältige ökologische Funktionen, im Zuge der Nutzbarmachung wurden sie jedoch zum Großteil entwässert. Problematisch daran: Die Habitatbedingungen ändern sich, moortypische Arten verschwinden und mooruntypische Arten wie die bedrohte Bachmuschel nutzen sie als Sekundärlebensraum. Dies kann bei Moorschutzmaßnahmen zur Herausforderung werden. Die Notiz zeigt Lösungsansätze und gibt Empfehlungen, die das Artenschutzzentrum des Bayerischen Landesamtes für Umwelt auch in einem neuen Leitfaden veröffentlicht hat.
Intakte Moore haben wichtige Funktionen für Klima-, Wasser- und Artenschutz. Im letzten Jahrhundert wurden sie jedoch zur land- und forstwirtschaftlichen Nutzung sowie zur Torfgewinnung großflächig entwässert. Entwässerte Moore emittieren enorme Mengen an Treibhausgasen, da sich der Torfboden durch die Zufuhr von Sauerstoff zersetzt. Zudem bieten entwässerte Moore nicht mehr die Habitatbedingungen, die moortypische Arten benötigen, sodass sie als Lebensraum für diese Arten verloren gehen. Durch eine Anhebung des Wasserstandes kann die Zersetzung der Moorböden gestoppt werden. Dies ermöglicht, dass sich eine moortypische Flora und Fauna wieder ansiedelt. Teilweise werden entwässerte Moore als Sekundärlebensraum von nichtmoortypischen, geschützten Arten genutzt. Dadurch kann es bei der Optimierung des Wasserstandes zu Zielkonflikten kommen.
Eine dieser nichtmoortypischen Arten ist die Bachmuschel (Unio crassus agg.) aus der Familie der Flussmuscheln (Unionidae; NAGEL 2015). Durch anthropogene Veränderung der Lebensräume sind die Bachmuschelbestände in Europa in den letzten 75 Jahren massiv zurückgegangen. Heute ist sie nach Bundesnaturschutzgesetz streng und nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie europaweit geschützt. Auf der Roten Liste Bayern sowie Deutschland ist sie als vom Aussterben bedroht (Kategorie 1) aufgeführt (LFU 2022a; BFN 2023; WIESE et al. 2006). Da ihre Lebensräume zum Großteil verändert oder zerstört wurden, nutzt die Muschel unter anderem Entwässerungsgräben in Mooren als Sekundärlebensraum.
Um negative Auswirkungen durch Moorschutzmaßnahmen auf die Bachmuschel zu verhindern, können Gräben durch Sohlbauwerke oder überfließbare Wehre angestaut und deren Durchgängigkeit erhalten werden. Eine Alternative zur Grabenverfüllung oder -anstauung stellt die Gewässermäandrierung dar, bei der das Wasser länger in der Landschaft verweilt und die Vertiefung der Gewässersohle verringert wird. Ist der Gewässerabschnitt mit Bachmuscheln direkt oder indirekt (beispielsweise durch Sedimenteinträge) von gewässerbaulichen Maßnahmen betroffen, sind die Bachmuscheln vor der Umsetzung der Maßnahmen abzusammeln. Sind die alternativen Anstaumaßnahmen keine Option, kann die Bachmuschel durch fachkundiges Personal in ein nahegelegenes, geeignetes Habitat umgesiedelt und so die Population erhalten werden.
Die Wahl der geeigneten Maßnahme ist einzelfallbezogen abzuwägen. Zu berücksichtigen sind etwa der Zustand des betroffenen Bachmuschelhabitates sowie der Population, Lage und Zustand des Ausweichhabitates, der Zeit- und Kostenaufwand sowie die Stauziele. Ausweichhabitate sollten für eine Umsiedlung vorab einer Schwachstellenanalyse unterzogen werden. Anschließend lassen sie sich beispielsweise durch Pflanzung von Ufergehölzen oder durch ungedüngte Pufferstreifen am Gewässerrand optimieren (LFU 2022b).
Ist die Reproduktionsrate der Bachmuschel eingeschränkt, kann eine Wirtsfischinfizierung die Reproduktion anregen (FELDHAUS et al. 2015). Begleitend zur Umsiedlung von Bachmuscheln ist ein wissenschaftliches Monitoring unerlässlich. Dieses ermöglicht ein frühzeitiges Gegensteuern mit geeigneten Maßnahmen, sollte die Bachmuschelpopulation einen rückläufigen Bestandstrend aufweisen. Beispielsweise kann sich eine extensive Beweidung gegenüber einer ackerbaulichen Nutzung durch verringerte Nähstoff- und Sedimenteinträge in die Gewässer positiv auf die Bachmuschel auswirken. Eine Auszäunung des Gewässers gegenüber dem Vieh kann eine Störung der Gewässersohle, erhöhten Sedimenteintrag sowie ein Zertreten der Muscheln verhindern (LFU 2022b).
Mit den aufgeführten Lösungsansätzen kann zum einen vermieden werden, dass Moorschutzmaßnahmen durch ein Auftreten der Bachmuschel grundsätzlich verhindert werden. Zum anderen werden die artenschutzrechtlichen Belange beim Moorschutz berücksichtigt.
Das Bayerische Artenschutzzentrum des Bayerischen Landesamtes für Umwelt greift die Thematik in einem neuen Leitfaden auf, der über den Bestellshop des Umweltministeriums bezogen werden kann: www.bestellen.bayern.de/shoplink/lfu_nat_00486.htm. Er bietet Handlungsempfehlungen für Moorschutzpraktikerinnen und -praktiker und beschreibt Lösungsansätze zum Umgang mit geschützten, aquatisch gebundenen Arten wie der Bachmuschel, dem Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis), der Knoblauchkröte (Pelobates fuscus), der Vogel-Azurjungfer (Coenagrion ornatum) und der Helm-Azurjungfer (Coenagrion mecuriale).
Literatur
LFU (= BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT, Hrsg., 2022a): Rote Liste und Gesamtartenliste Bayern – Weichtiere Mollusca. – Bearbeiter: COLLING, M., Augsburg: 39 S.
LFU (= BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT, Hrsg., 2022b): Bachmuschelkartierung (Unio crassus) im Oberbayerischen Donaumoos. – Bearbeiter: ANSTEEG, O. & HOCHWALD, S., Augsburg: 80 S.; unveröffentlicht.
BFN (= BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ, Hrsg., 2023): WISIA online – Wissenschaftliches Informationssystem zum Internationalen Artenschutz. – Artenschutzdatenbank des Bundesamtes für Naturschutz in Bonn; wisia.de/FsetWisia1.de.html (abgerufen am 22.03.2024).
FELDHAUS, G., LAKMANN, G. & STEINBERG, L. (2015): Schutz und Erhalt der Bachmuschel. – Ein Artenschutzprojekt im Kreis Paderborn. – In: Natur in NRW: 1(15): 29–33.
NAGEL, K.-O. (2015): Biologie der Muscheln. – In: HMUKLV & HESSEN-FORST FENA (Hrsg.): Atlas der Fische Hessens – Verbreitung der Rundmäuler, Fische, Krebse und Muscheln. – FENA Wissen, Band 2: 374–379.
WIESE, V., BECKMANN, K.-H. & KOBIALKA, H. (2006): Die Gemeine Flussmuschel Unio crassus – Weichtier des Jahres 2006. – In: Club Conchylia Informationen: 37(3/4): 56–59.
Mehr
Handlungsempfehlungen für Moorschutzpraktikerinnen und -praktiker im Umgang mit geschützten Arten – Aquatisch gebundene Arten (Bericht zum Download hier verfügbar): www.bestellen.bayern.de/shoplink/lfu_nat_00486.htm
Autorin
Nadine Gebhardt
Bayerisches Landesamt für Umwelt
Bayerisches Artenschutzzentrum – Projekt Biodiversität und Moorschutz
nadine.gebhardt@lfu.bayern.de
Nadine Gebhardt (2026): Die Bachmuschel in Entwässerungsgräben: Wie Moor- und Artenschutz Hand in Hand gehen. – Anliegen Natur 48/1; www.anl.bayern.de/publikationen/anliegen/meldungen/wordpress/bachmusches-entwaesserung/.

 | 0
| 0