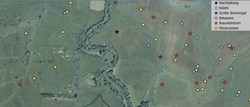Wettbewerb Naturschutzpartner Landwirt 2018
(Johanna Schnellinger) Landwirte sind wichtige Partner für den Erhalt der heimischen Tier- und Pflanzenarten sowie der Vielfalt der bayerischen Kulturlandschaften. Um ihr Engagement zu honorieren, startete das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV) gemeinsam mit dem Bayerischen Bauernverband (BBV) den Wettbewerb „Naturschutzpartner Landwirt 2018“. Auf einer Preisverleihung werden besonders verdiente Landwirte ausgezeichnet.
Knapp die Hälfte der Fläche Bayerns wird landwirtschaftlich genutzt. Landwirte produzieren darauf nicht nur pflanzliche und tierische Erzeugnisse, sondern sie prägen auch das Bild unserer Landschaft. Ob Ackerbauer oder Milchviehhalter, Schäfer oder Teichwirt, jeder Betrieb ist ein wichtiger Partner für den Erhalt der heimischen Tier- und Pflanzenarten sowie der Vielfalt der bayerischen Kulturlandschaften. Durch naturschonende Bewirtschaftung können sie einen entscheidenden Beitrag leisten, diese Kulturlandschaft zu erhalten. Viele Betriebe nehmen bereits heute an einem Agrarumweltprogramm teil oder engagieren sich bei anderen Initiativen und Projekten.

 | 1
| 1