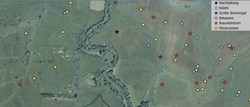Europäische Studie: Biodiversität profitiert kaum von Ökologischen Vorrangflächen

Untersaaten, wie hier beim Maisanbau, können zwar die Bodenerosion vermindern, sind jedoch aus Expertensicht irrelevant für die Förderung von Biodiversität (Foto: Volker Prasuhn/Wikimedia Commons).
(Monika Offenberger) Ökologische Vorrangflächen, kurz ÖVF, sollen im Rahmen des Greenings dem alarmierenden Rückgang der Agro-Biodiversität entgegenwirken. Zur Umsetzung haben die Landwirte zahlreiche Optionen, etwa die Anlage von Blühstreifen, den Erhalt von Landschaftselementen oder eine besonders umweltschonende Bewirtschaftung. Ein internationales Team von Wissenschaftlern untersuchte die Effizienz der möglichen ÖVF-Optionen seit Einführung des Greenings 2015. Das Fazit: In der EU wurden seither nur auf einem Viertel der ÖVF Optionen umgesetzt, die nachweislich der Biodiversität zugutekommen; in Deutschland ist der Anteil noch geringer.
Der dramatische Artenrückgang in der Agrarlandschaft sowie anhaltend hohe Nährstoffeinträge in Böden und Gewässer mahnen eine stärkere Ökologisierung der Landwirtschaft an. Als Konsequenz hat die EU-Kommission mit der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik eine „grünere“ 1. Säule bei der Förderung von Landwirten beschlossen. Ein Teil der Direktzahlungen ist seit dem 1. Januar 2015 an Bewirtschaftungsmethoden gebunden, die den Klima- und Umweltschutz fördern. Im Fokus stehen drei Handlungsfelder: Die Landwirte sind verpflichtet, eine Fruchtfolge einzuhalten, Dauergrünland zu erhalten sowie auf mindestens fünf Prozent ihrer Ackerflächen ökologische Vorrangflächen bereitzustellen. Insbesondere die ÖVF sollen der heimischen Fauna und Flora zugutekommen. Wie wirksam diese Greening-Maßnahme für den Artenschutz tatsächlich ist, wurde in einer europaweiten Studie untersucht.
 | 0
| 0