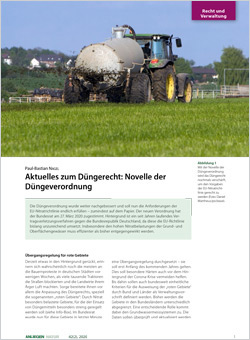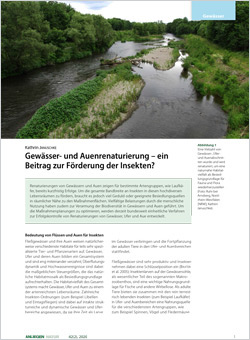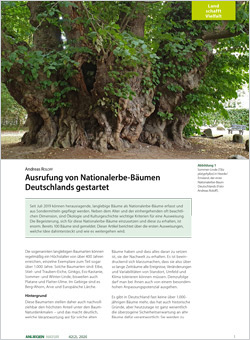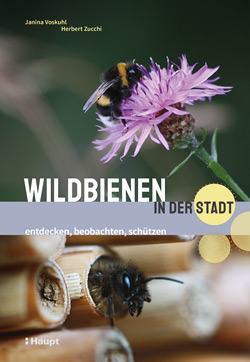Weltweites Projekt zum Mitmachen bis 22. Mai – „Dawn Chorus 2020“ (Vogelkonzert)
(Michael John Gorman, Auguste von Bayern) Seit den Beschränkungen durch die Corona-Pandemie ist es in unseren Städten und Dörfern ungewöhnlich still geworden. In dieser Stille werden jedoch die Stimmen der Natur wieder umso deutlicher hörbar. Jetzt im Frühjahr findet das frühmorgendliche Vogelkonzert statt und bietet eine wunderbare Gelegenheit für ein besonderes Naturerlebnis: Hören Sie gemeinsam mit Kindern, wie Artenvielfalt klingt!
In dieser Zeit starten wir, das entstehende BIOTOPIA Naturkundemuseum Bayern, ein neues, globales Citizen Science-Projekt „Dawn Chorus 2020“ und bitten Sie um Ihre Mithilfe!
„Dawn Chorus“ richtet sich an jedermann, aber im Besonderen an Schulklassen und Familien. Es soll in dieser für alle so herausfordernden Zeit, Neugier und Forscherdrang der Kinder entfachen, Begeisterung und Empathie für die Artenvielfalt vor der eigenen Haustür wecken sowie auf den Rückgang der Biodiversität aufmerksam machen.
Gemeinsam mit der Stiftung Nantesbuch, lädt BIOTOPIA, die in Bayern gerade neu entstehende Plattform für Life Sciences (Bio- und Umweltwissenschaften), weltweit Menschen ein, dem Morgenkonzert der Vögel vor Sonnenaufgang zu lauschen. Gleichzeitig bitten wir die Zuhörer, das Konzert mit dem Smartphone aufzunehmen und die Aufnahmen auf der Online-Plattform www.dawn-chorus.org hochzuladen. Dort werden die Vogelstimmen-Daten aus der ganzen Welt gesammelt und auf einer großen „Sound Map“ kartiert. Die Aufnahmen kann man ganz einfach mit dem Handy am eigenen Fenster, im Garten, Stadtpark oder auch im Wald machen.
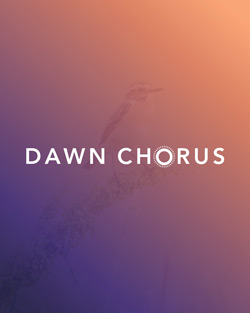
 | 0
| 0