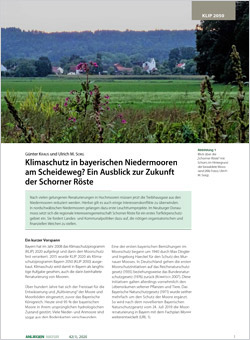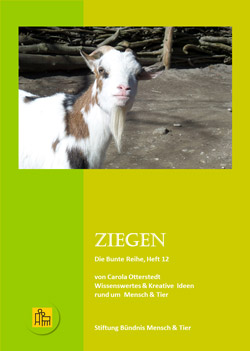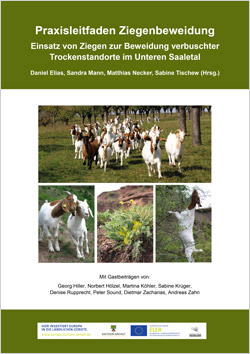Hier finden Sie aktuelle Ergebnisse, Publikationen und Ereignisse aus Wissenschaft und Naturschutz. Die hier vorveröffentlichten Kurznachrichten werden zweimal jährlich in der Zeitschrift ANLiegen Natur zusammenfassend publiziert.

Die meisten Substanzen werden bei heutigen Bewertungen der Gewässerqualität nicht berücksichtigt. Das Forscherkonsortium SOLUTION versucht die Überwachung und Bewertung der Wasserqualität europaweit zu verbessern (Foto: André Künzelmann).
(Monika Offenberger) Die Konzentrationen bestimmter Schadstoffe werden in den europäischen Gewässern überwacht. Doch wie wirken die Chemikalien in Kombination miteinander auf die Artengemeinschaft und wie schädlich sind die derzeit nicht kontrollierten Stoffe im Wasser? Ein internationales Forschungsteam aus mehr als 100 Wissenschaftlern hat neue Methoden zur Kontrolle der chemischen Wasserqualität erarbeitet und Möglichkeiten für die Umsetzung der wissenschaftlichen Erkenntnisse aufgezeigt.
Chemische Substanzen aus Landwirtschaft, Industrie und Haushalten beinträchtigen die Qualität europäischer Gewässer, schädigen deren aquatische Ökosysteme, vermindern die Artenvielfalt und gefährden die menschliche Gesundheit. Um diesen negativen Entwicklungen entgegenzutreten, wurde im Jahr 2000 die EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) durch die europäischen Mitgliedsstaaten beschlossen; sie zählt zu den weltweit strengsten Regelwerken ihrer Art. Seither wird der chemische Zustand eines Gewässers anhand von 45 Einzelstoffen bewertet. Weitere 67 Stoffe, die besonders schädlich für Tiere und Pflanzen sind, werden im Rahmen der ökologischen Zustandsbewertung gemessen. Das ist jedoch nur ein Bruchteil von den insgesamt mehr als 100.000 verschiedenen chemischen Substanzen, die aktuell in die Gewässer gelangen. Die meisten Substanzen werden bei der Bewertung der Gewässerqualität also gar nicht berücksichtigt. Darüber hinaus lässt sich durch die Messung der Einzelstoffe keine Aussage treffen, wie gefährlich der Schadstoff in der Umwelt in Kombination mit anderen wirkt. Wie kann man also die Überwachung und die Bewertung der chemischen Wasserqualität europaweit verbessern, ohne dass die Kosten explosionsartig steigen?
Weiterlesen »
Veröffentlicht am 10. März 2020
Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!
Keine Kommentare >> Kommentar abgeben
4426 mal aufgerufen | 0

| 0


Mit Hilfe einer neuen Versuchsplattform namens Ecotron will man am Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung Halle-Jena-Leipzig (iDiv) im Rahmen des „Jena-Experiments“ künftig auch komplexere Lebensgemeinschaften aus Pflanzen und diversen Bodenorganismen nachstellen und ihre Stoffflüsse analysieren (Foto: iDiv).
Monika Offenberger
Ökosystemforschung: Pflanzenvielfalt fördert Stabilität von Nahrungsnetzen
Artenreiche Ökosysteme sind weniger diversen Lebensgemeinschaften in vieler Hinsicht überlegen:
Sie produzieren mehr Biomasse, sind weniger anfällig gegenüber widrigen Umweltbedingungen und
reagieren robuster auf Störungen. Diese Zusammenhänge wurden von Ökologen schon vor Jahrzehnten anhand von Modellen vorhergesagt. Aktuelle Studien bestätigen die Theorie nun mit experimentellen Daten aus Waldparzellen in Panama und China sowie durch Langzeitbeobachtungen an experimentell gestalteten und an unterschiedlich genutzten Grasländern in Deutschland. Die Studien werden überschattet von einem generellen dramatischen Rückgang der deutschen Insektenfauna.
Summary
Ecosystem research: Plant diversity promotes stability of food webs
Species-rich ecosystems are in many ways superior to less diverse communities: they produce more biomass, are less susceptible to adverse environmental conditions, and are more resilient to disturbances. These relationships were predicted by ecological models decades ago. Recent studies now confirm this theory with experimental data from forest plots in Panama and China as well as long-term observations of experimentally designed and differently used grasslands in Germany. The studies are overshadowed by a general dramatic decline of insects in Germany.
Weiterlesen »
Veröffentlicht am 26. Februar 2020
Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!
1 Kommentar >> Kommentar abgeben
7325 mal aufgerufen | 1

| 0


Zahlreiche Semester der Landwirtschaftsschulen und Fachschulen für Agrarwirtschaft beteiligten sich am Wettbewerb (Foto: Hase/StMELF).
(Bettina Burkart-Aicher) „Biodiversität – Erzeugung gestalten, Arten erhalten“ lautete der ambitionierte Titel eines Wettbewerbs, den das Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 2019 ausgelobt hat. Mitmachen konnten die 1. und 2. Semester der Landwirtschaftsschulen, Abteilungen Landwirtschaft und Hauswirtschaft, sowie die 1. und 2. Semester der Fachschulen für Agrarwirtschaft, Fachrichtung Ökologischer Landbau in Bayern.
Ein attraktives Preisgeld und große Anerkennung motivierte trotz kurzer Ausschreibungsfrist 12 Gruppen. Die entwickelten Ideen erhalten oder verbessern die Biodiversität und überzeugen auch mit Blick auf die praktische Umsetzung in den Betrieben. Da sich nur gesamte Semester bewerben durften, war es unabdingbar, sich in der Gemeinschaft mit dem Thema auseinanderzusetzen und gemeinsam innovative Ansätze und Konzepte zu erarbeiten.
Weiterlesen »
Veröffentlicht am 26. Februar 2020
Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!
Keine Kommentare >> Kommentar abgeben
5090 mal aufgerufen | 0

| 0


Im Klimaschutzprogramm Bayern 2050 werden Moore renaturiert. Dadurch verbessert sich nicht nur unsere Klimabilanz, auch viele Arten profitieren davon. Hier das Scheiden- Wollgras – eine Zielart der Hochmoorrenaturierung (Foto: Richard Schöttner).
Giorgio Demartin, Richard Schöttner, Cornelia Siuda, Veronika Feichtinger, Robert Hofmann und Manfred Scheidler
Moorrenaturierungen im Klimaschutzprogramm Bayern 2050 – Handwerkszeug, Beispiele und Herausforderungen
Über das Klimaschutzprogramm Bayern 2050 (KLIP 2050) werden auch Moore renaturiert, um Treibhausgas einzusparen. Projektmitarbeiter („KLIP-Manager“) an den höheren Naturschutzbehörden in den fünf moorreichen Regierungsbezirken bringen diese Renaturierungen voran. Die Förderkulisse des Programms ist sehr weit gefasst. Zwei Kriterien sind jedoch wesentlich: Organischer Boden und Klimarelevanz. Grundlegendes Ziel ist es, den moortypischen Wasserhaushalt und die standorttypische Vegetation wieder zu etablieren. Die „KLIP-Manager“ setzen die Moorschutzmaßnahmen in Zusammenarbeit mit den unteren Naturschutzbehörden und örtlichen Trägern um. Beispiele verdeutlichen die bisherige erfolgreiche Vorgehensweise. Wir diskutieren, wie der Moorschutz noch besser und effizienter gestaltet werden kann, um den Herausforderungen des Klimaschutzes gerecht zu werden.
Summary
Mire Restoration in Bavaria by “KLIP 2050”
The climate protection program 2050 (KLIP 2050) in Bavaria also restores mires to save greenhouse gas. Project employees („KLIP managers“) and higher nature conservation authorities in the five bog-rich government districts push this renaturation-process forward. The field of funding of the program is very broad. However, two criteria are essential: organic soil and climate relevance. The basic goal is to re-establish the bog water balance and the vegetation typical of the location. The „KLIP Managers“ implement the moor protection measures in cooperation with the lower nature conservation authorities and local agencies. Examples from the moor-rich government districts illustrate the successful approach to date. We discuss how bog protection can be designed better and more efficiently in order to meet the challenges of climate protection.
Weiterlesen »
Veröffentlicht am 20. Februar 2020
Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!
1 Kommentar >> Kommentar abgeben
7605 mal aufgerufen | 1

| 0

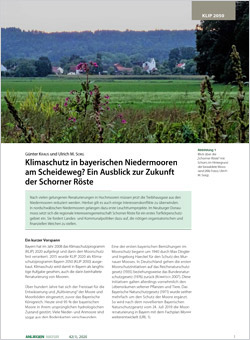
Blick über die „Schorner Röste“ mit Schorn; im Hintergrund der bewaldete Moosrand (Alle Fotos: Ulrich M. Sorg).
Günter Kraus und Ulrich M. Sorg
Klimaschutz in bayerischen Niedermooren am Scheideweg? Ein Ausblick zur Zukunft der Schorner Röste
Nach vielen gelungenen Renaturierungen in Hochmooren müssen jetzt die Treibhausgase aus den Niedermooren reduziert werden. Hierbei gilt es auch einige Interessenskonflikte zu überwinden. In nordschwäbischen Niedermooren gelangen dazu erste Leuchtturmprojekte. Im Neuburger Donaumoos setzt sich die regionale Interessensgemeinschaft Schorner Röste für ein erstes Torfkörperschutzgebiet ein. Sie fordert Landes- und Kommunalpolitiker dazu auf, die nötigen organisatorischen und finanziellen Weichen zu stellen.
Summary
Climate protection in Bavarian fens at the crossroads? An outlook on the future of the “Schorner Röste”
After a number of successful renaturated raised bogs, the greenhouse gases from the fens must now be reduced. Therefore some conflicts of interest must be overcome. In northern Swabian fens, first lighthouse projects are successfull. In the Neuburger Donaumoos however, the regional interest group Schorner Röste is campaigning for a first peat body protection area. It calls on state and local politicians to make the necessary organizational and financial decisions.
Weiterlesen »
Veröffentlicht am 20. Februar 2020
Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!
Keine Kommentare >> Kommentar abgeben
6177 mal aufgerufen | 0

| 0


Die angepasste Pflege einer Straßenböschung zeigt Erfolge (Foto: LPV Passau e. V.).
Carmen Vidal und Franz Elender
Biodiversitätsprojekt „Blühendes Passauer Land“
Im Biodiversitätsprojekt „Blühendes Passauer Land“ des Landkreises Passau werden seit gut zehn Jahren erfolgreich artenreiche Lebensräume für Wildbienen und andere Insekten geschaffen und vernetzt. Davon profitieren wiederum auch Vögel und Fledermäuse, die auf ein reichhaltiges Nahrungsangebot angewiesen sind. Kommunen, Bauhöfe und Privatpersonen sind eingebunden und engagieren sich so für den Naturschutz.
Summary
The Biodiversity Projekt “Blühendes Passauer Land”
In the Biodiversity Project „Blühendes Passauer Land“ of the district of Passau, for about 10 years species-rich habitats for wild bees and other insects are created and networked. This in turn benefits also birds and bats, which depend on a rich food supply. Municipalities, construction yards and citizens are involved and are thus committed to nature conservation.
Weiterlesen »
Veröffentlicht am 18. Februar 2020
Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!
Keine Kommentare >> Kommentar abgeben
6313 mal aufgerufen | 3

| 0

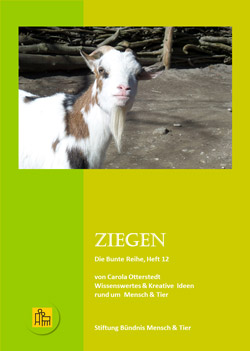
Titelbild des Booklets „Ziegen“.
(Bettina Burkart-Aicher) Belege für die Haltung von Ziegen in Mitteleuropa existieren ab etwa 7.000 v. Chr., Ziegen zählen weltweit zu den ältesten Haustierrassen. Im deutschsprachigen Raum wird heutzutage ein Großteil der Ziegen in der Landwirtschaft und zunehmend in der Landschaftspflege gehalten. Ziegenbeweidung ist eine optimale Erstpflegemaßnahme für Trockenrasen, steile Hänge und andere von einer Verbuschung bedrohte Trockenstandorte. Sie eignen sich aber auch sehr gut für die Beweidung von Standorten, auf denen Rinder, Pferde und Schafe kein ausreichendes Futter finden würden oder die für diese zu steil beziehungsweise zu felsig sind.
Weiterlesen »
Veröffentlicht am 18. Februar 2020
Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!
Keine Kommentare >> Kommentar abgeben
4985 mal aufgerufen | 0

| 0

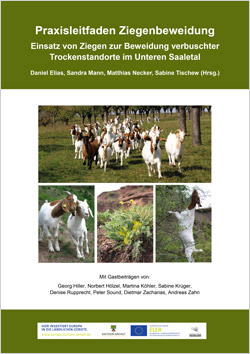
Titelbild des „Praxisleitfadens Ziegenbeweidung“.
(Bettina Burkart-Aicher) Bereits 2007 wurden im Unteren Saaletal (Sachsen-Anhalt) erste Flächen zur Beweidung mit Ziegen eingerichtet. Mit Fördermitteln aus dem ELER-Fonds (Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums) vom Land Sachsen-Anhalt und der Heidehofstiftung konnte die Hochschule Anhalt ein Modellprojekt mit rotierenden Ziegenweiden entwickeln. Aktuell werden 16 Flächen im Unteren Saaletal mit Ziegen, teilweise gemeinsam mit Schafen, beweidet. Die Flächen befinden sich in Natura 2000-Gebieten und weisen eine noch artenreiche Trockenrasen-Flora und -Fauna auf, die aber durch stark verbuschte Strukturen in zum Teil extremer Steillage und durch Vergrasungen akut bedroht ist.
Weiterlesen »
Veröffentlicht am 18. Februar 2020
Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!
Keine Kommentare >> Kommentar abgeben
4347 mal aufgerufen | 0

| 0


Mehr als 300 Teilnehmer folgten der Einladung der ANL zum Fachsymposium „Insektenschwund – Wege aus der Krise“ (Foto: Melanie Schuhböck/ANL).
Gerti Fluhr-Meyer und Katharina Stöckl-Bauer
Insektenschwund – Wege aus der Krise: Bericht über ein internationales Fachsymposium
Das Insektensterben hat sich beschleunigt – aber was daraus folgt, darüber herrscht noch Unklarheit. Dies ist der beunruhigende Befund eines Fachsymposiums, das zum Abschluss des Schwerpunktjahres 2019 „InsektenVielfalt“ der ANL am 5. Dezember 2019 im Münchner Schloss Nymphenburg stattfand. Mehr als 300 Wissenschaftler, Verbandsvertreter, Landwirte und Interessierte diskutierten, wie eine Trendwende im Insekten- und Artenschutz gelingen kann. Die abschließende Podiumsdiskussion zeigte einmal mehr, wie schwierig und wichtig der Dialog zwischen den einzelnen Akteuren im Insektenschutz ist.
Summary
Insect Loss – Ways out of the Crisis: Report on an International Symposium
Insect loss has accelerated – but the next steps are still unclear. This is the worrying finding of a specialist symposium that took place on 5 December 2019 in the Nymphenburg Palace in Munich. More than 300 scientists, association representatives, farmers and other interested parties discussed how a turnaround in insect and species protection can be successful. The final panel discussion once again showed how difficult and important the dialogue between the individual actors in insect protection is.
Weiterlesen »
Veröffentlicht am 12. Februar 2020
Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!
2 Kommentare >> Kommentar abgeben
8101 mal aufgerufen | 0

| 0


Ines Langensiepen leitet seit Ende 2019 das neu gegründete Bayerische Artenschutzzentrum am Landesamt für Umwelt (Foto: Marie Pröpper).
Paul-Bastian Nagel
Interview mit Ines Langensiepen
Leiterin des Bayerischen Artenschutzzentrums am Landesamt für Umwelt
Angesichts des Rückgangs der Artenvielfalt, hat die Bayerische Staatsregierung die Naturoffensive Bayern gestartet. Ein Kernelement des Maßnahmenpakets ist die Einrichtung des Bayerischen Artenschutzzentrums (BayAZ). Seit Oktober 2019 leitet Ines Langensiepen, bisher Referatsleiterin im Referat „Fachgrundlagen Naturschutz“ am Landesamt für Umwelt, das BayAZ. Wir wollten von ihr wissen, wie die Ziele umgesetzt werden sollen und welche Chancen und Herausforderungen Sie dabei sieht.
Weiterlesen »
Veröffentlicht am 12. Februar 2020
Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!
Keine Kommentare >> Kommentar abgeben
6124 mal aufgerufen | 0

| 0

Weitere Artikel:

 | 0
| 0