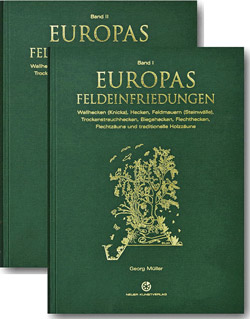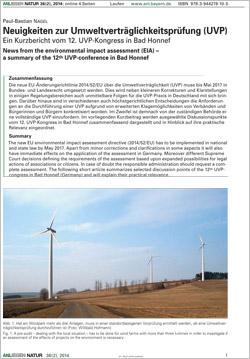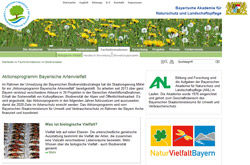Die Wirkung des Mähens auf die Fauna der Wiesen
Dennis van de Poel und Andreas Zehm
https://doi.org/10.63653/wmee0843
Die vorliegende Literaturstudie befasst sich mit der Gefährdung tierischer Organismen durch die Wiesenmahd sowie mit Ansätzen, diese Gefährdung abzumildern. Zur tierschonenden Mahd stehen dem Bewirtschafter verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Als am wirkungsvollsten haben sich diejenigen Maßnahmen gezeigt, welche in einem bestimmten Gebiet oder zu einer bestimmten Zeit auf das Mähen verzichten. Altgrasstreifen, Rotationsbrache, Schnittzahlreduzierung und Verzögerung des ersten Schnitts sind die Mittel der Wahl. Auch Befahrmuster und Scheuchvorkehrungen, welche die Tiere aus der Fläche in eventuell vorhandene Refugien treiben, sind wirkungsvoll und einfach umzusetzen. Ziel sollte sein, möglichst wenig Fläche zu befahren – durch eine Vergrößerung beziehungsweise Vereinheitlichung der Arbeitsbreite, da dies bereits einen deutlichen Einfluss auf die Überlebenswahrscheinlichkeit der Tiere hat.

 | 0
| 0