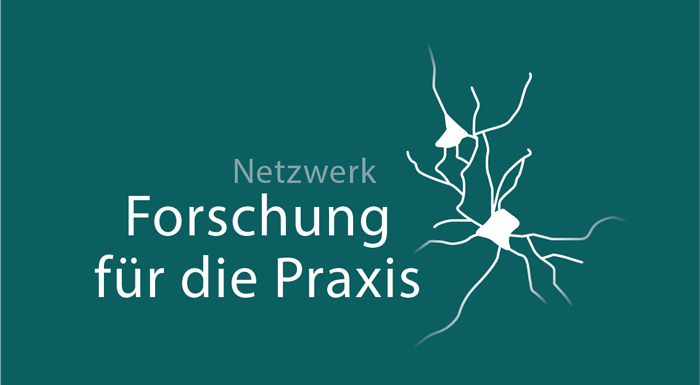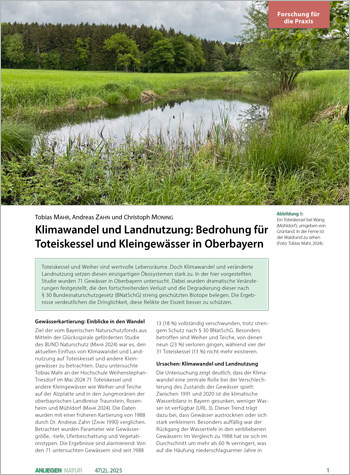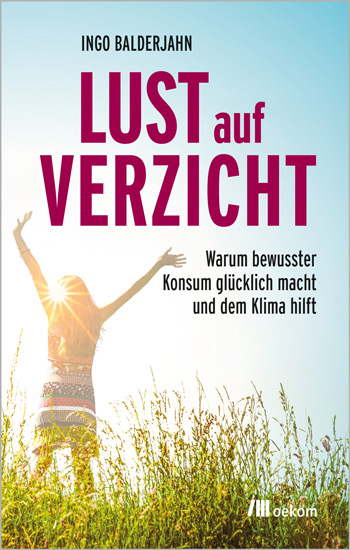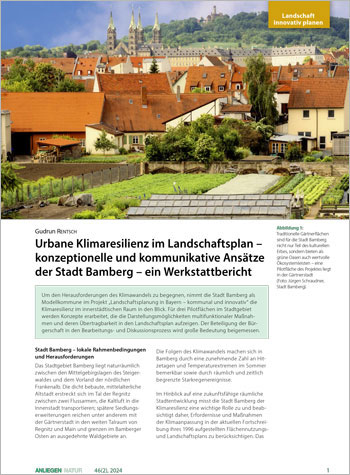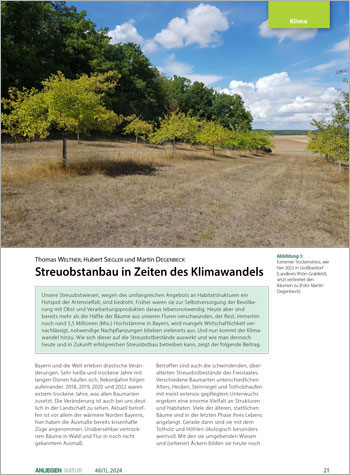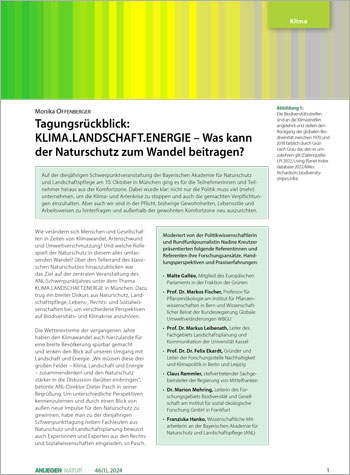Der Apollofalter (Parnassius apollo) – Gewinner oder Verlierer im Klimawandel?
(Adam Geyer) Besonders heiße und trockene Phasen wirken sich unerwartet problematisch auf den Apollofalter aus – eine Art, die ansonsten Wärme liebt. In extrem trockenen Jahren fehlt es den Raupen an Nahrung, weil der Mauerpfeffer zurückgeht. Damit der Falter trotz der wechselnden Bedingungen überleben kann, braucht er langfristig sehr gut vernetzte Lebensräume. Ein großräumiger Biotopverbund mit unterschiedlich strukturierten Gebieten ist daher unabdingbar, um Klimaschwankungen ausgleichen zu können.
Der Apollofalter (Parnassius apollo) entwickelt nur eine Generation im Jahr. Seine Raupe überwintert, bereits fertig entwickelt, im Ei. Wenn sie im zeitigen Frühjahr schlüpft, benötigt sie Wärme, die deutlich über der zu dieser Zeit herrschenden Lufttemperatur liegt. Unbewachsene, südexponierte Felsen bieten dies, indem sie sich durch Sonneneinstrahlung erwärmen, die Wärme speichern und wieder zeitversetzt abgeben. Dieser „Kachelofeneffekt“ kann direkt auf die Raupen einwirken, auch wenn diese sich auf ihrer Fraßpflanze, dem Weißen Mauerpfeffer (Sedum album), befinden, weil dieser flach auf der Felsoberfläche wächst. Diese starke Wärmeabhängigkeit betrifft vor allem die ersten zwei Raupenstadien während der Monate März und April. Untersuchungen an einem Vorkommen in der Fränkischen Schweiz haben gezeigt, dass Kältephasen, die länger als fünf bis sechs Tage andauern – und nicht durch Sonneneinstrahlung unterbrochen werden – zu einer erhöhten Mortalität führen (GEYER 1991, 1992; GEYER & DOLEK 1995, 2001; GEYER 2019).
Nachdem aufgrund des Klimawandels mittlerweile bereits im März relativ hohe Temperaturen auftreten, sollte dies den Raupen eigentlich zugutekommen. Tatsächlich wird der Schlupf der Raupen dadurch sehr früh ausgelöst, aber die hohen und meist auch mehrere Tage andauernden Temperaturen führen auch dazu, dass nahezu alle Raupen schlüpfen. Man kann dies daran erkennen, dass sich die Raupen in einem ähnlichen Alter befinden. Tritt dann eine längere Kältewelle auf, wie dies zum Beispiel Mitte April des Jahres 2019 der Fall war, resultiert eine hohe Mortalitätsrate, die nicht durch nachschlüpfende Raupen abgefedert werden kann. Im Jahr 2019 führte dies zu einem starken Einbruch der fränkischen Population, der Rückgang lag bei über 77 % gegenüber dem Vorjahr (GEYER et al. 2019)! Ähnliche Situationen traten in den folgenden Jahren auf, sodass sich die Population – nach einer Erholung im Jahr 2022 – bis zum Sommer des Jahres 2024 wieder abschwächte (GEYER et al. 2024; LAUßMANN et al. 2025). In den Frühjahren des Zeitraums 1980/1990, die vergleichsweise einen deutlich langsameren Anstieg der Temperaturen aufwiesen, schlüpften die Raupen zeitversetzt über einen längeren Zeitraum. Raupen, die erst nach einer Kältewelle schlüpften, entgingen der hier wirkenden Mortalität, weil sie sich zu dieser Zeit noch in ihrem schützenden Ei befanden. Dies ist nun anders, denn der sehr früh ausgelöste Schlupf nahezu aller Raupen bedingt ein erhöhtes Risiko.

 | 0
| 0